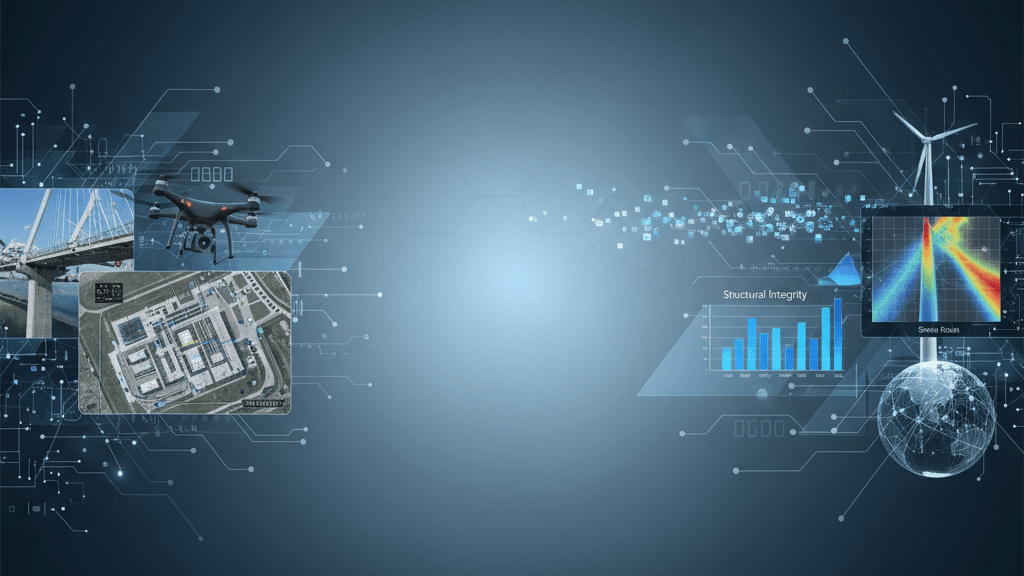Viele Unternehmen, die Drohnen für Infrastrukturinspektionen einsetzen, erhalten regelmäßig Anfragen von Behörden zu durchgeführten Flügen. In solchen Situationen ist es entscheidend, schnell und vollständig auskunftsfähig zu sein. Doch welche rechtlichen Grundlagen gelten? Und wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie alle Anforderungen erfüllen?
Die rechtliche Grundlage: Wann gilt die Flugbuchpflicht?
Die Flugbuchpflicht für Drohnen ist in Deutschland nicht pauschal für alle gewerblichen Drohnenflüge vorgeschrieben, wie oft angenommen wird. Entscheidend ist die Betriebskategorie nach der EU-Drohnenverordnung (EU) 2019/947, die seit dem 01.01.2021 gilt:
Offene Kategorie (A1, A2, A3)
In der offenen Kategorie – die den Großteil der gewerblichen Infrastrukturinspektionen abdeckt – besteht keine gesetzliche Flugbuchpflicht. Dies gilt sowohl für private als auch für gewerbliche Flüge, solange die Betriebsvoraussetzungen der offenen Kategorie eingehalten werden (max. 25 kg, max. 120 m Höhe, Sichtflug etc.).
Spezielle Kategorie (SPECIFIC)
Anders sieht es in der speziellen Kategorie aus: Hier wird eine Betriebsgenehmigung nach EU-VO 2019/947 benötigt, und die zuständige Luftfahrtbehörde kann im Rahmen dieser Genehmigung eine Flugbuchpflicht als Auflage vorschreiben. In der SPECIFIC-Kategorie ist in der Regel ein Betriebshandbuch erforderlich, das auch Aufzeichnungen über Flüge umfassen muss. Die konkreten Auflagen werden individuell festgelegt.
Wichtig! Auch wenn in der offenen Kategorie keine gesetzliche Pflicht besteht, ist die Führung eines Flugbuchs aus folgenden Gründen dringend zu empfehlen:
Was sollte dokumentiert werden?
Unternehmen, die ihre Drohnenflüge systematisch dokumentieren, sind bei Behördenanfragen klar im Vorteil. Folgende Angaben sollten erfasst werden:
Zusätzlich empfehlen Experten die Dokumentation von Akkustand, besonderen Vorkommnissen, Wetterbedingungen sowie dem konkreten Projektbezug. Gerade bei sicherheitskritischen Infrastrukturinspektionen kann diese erweiterte Dokumentation im Schadensfall oder bei behördlichen Anfragen entscheidend sein.
Aufbewahrungspflicht und Auskunftsfähigkeit
Wenn eine Flugbuchpflicht besteht (z.B. durch Auflagen in der speziellen Kategorie), muss das Flugbuch bis zu zwei Jahre aufbewahrt und auf Nachfrage von Behörden vorgelegt werden. Bei Audits, Versicherungsfällen oder behördlichen Kontrollen müssen Unternehmen sofort auskunftsfähig sein. Cloud-basierte Lösungen wie die FlyNex Plattform bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Die Daten sind jederzeit und von überall abrufbar, DSGVO-konform auf deutschen Servern gespeichert und gegen Verlust gesichert.
Das Problem: Manuelle Dokumentation ist fehleranfällig und zeitaufwendig
In der Praxis führen viele Infrastrukturbetreiber ihre Flugdokumentation noch immer manuell – sei es in Papierform oder in Excel-Tabellen. Die Konsequenzen:
Die Lösung: Automatisierte Flugdokumentation
Moderne Flottenmanagement-Systeme eliminieren diese Probleme durch vollständige Automatisierung. Plattformen wie FlyNex erfassen alle relevanten Flugdaten automatisch und stellen sie revisionssicher bereit:
Fazit: Vorbereitung zahlt sich aus
Auch wenn nicht alle gewerblichen Drohnenflüge einer gesetzlichen Flugbuchpflicht unterliegen, ist eine systematische Dokumentation unverzichtbar. Unternehmen, die bei Behördenanfragen schnell und vollständig auskunftsfähig sind, vermeiden nicht nur rechtliche Risiken, sondern profitieren auch von effizienteren Prozessen und besserer Nachvollziehbarkeit.
Automatisierte Lösungen reduzieren den administrativen Aufwand erheblich und schaffen die Grundlage für professionelles, rechtssicheres Drohnenmanagement – von der Planung über die Durchführung bis zur revisionssicheren Dokumentation.
Wer heute noch manuell dokumentiert, verschwendet nicht nur Ressourcen – er geht auch unnötige rechtliche Risiken ein.